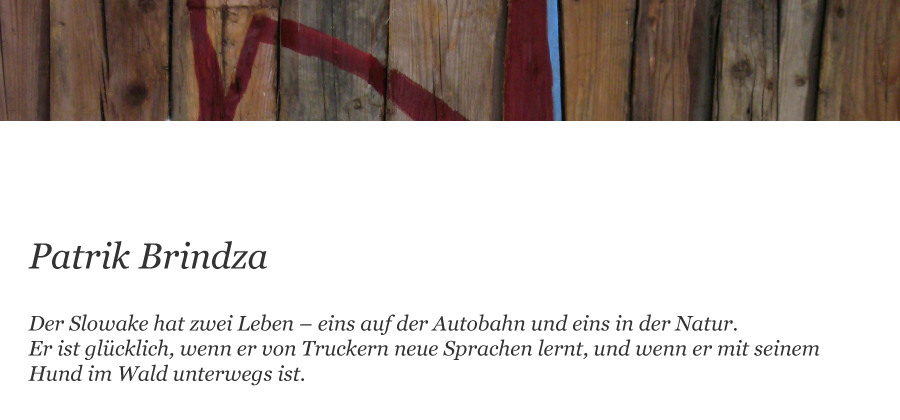Geboren am 6. Mai 1983; Polizist
Kurz vor der slowakisch-ungarischen Grenze sehen wir zum ersten Mal die rote Kelle: Anhalten, Rausfahren, Polizeikontrolle. Ein junger Polizist kommt in der weißen Uniform der slowakischen Autobahnpolizei ans Busfenster und bittet mit einem umwerfenden Lächeln um Führerschein und Fahrzeugpapiere. Ohne Vignette zu fahren könne bis zu 140 Euro kosten, erklärt er in fließendem Deutsch, wir kommen aber deutlich günstiger weg. Außerdem erklärt er sich sofort bereit, auf unserem Rückweg bei Nirgendsland mitzumachen. Drei Wochen später dürfen wir unseren Bus (mit Vignette am Fenster!) in seinem Garten unter dem ausladenden Walnussbaum parken, den er als kleiner Junge mit seinem Großvater gepflanzt hat. Wenige Minuten später hat Patrik Brindza schon Bierbank und Tisch aufgebaut. Es dauert einige Zeit, bis wir ihm Fragen stellen können, denn erst mal möchte er alles über uns und unsere Reise wissen.
„Als Polizist ist jeder Tag anders.
Während einer 12-Stunden-Schicht bin ich nur eine Stunde im Büro, den Rest der Zeit bin ich auf der Autobahn unterwegs. Wir fahren zum Beispiel zur polnisch-slowakischen Grenze oder ins Tatra-Gebirge und überprüfen LKWs und Kleinbusse, ob sie nicht zu schwer beladen sind. Wenn sie ihr maximales Gewicht überschreiten, ist das gefährlich, weil etwa die Bremsen nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten. Außerdem kontrollieren wir, ob sie die Maut bezahlt haben.
Bei 99 Prozent der deutschen Fahrer ist leider alles korrekt. Aber wenn wir doch mal Deutsche stoppen, bin immer ich für sie zuständig, weil ich so gern deutsch spreche. Ich habe das in der Schule gelernt. Eine weitere Sprache, die mir sehr gut gefällt, ist Polnisch. Als ich vor fünf Jahren angefangen habe zu arbeiten, habe ich die polnischen Fahrer überhaupt nicht verstanden. Inzwischen verstehe ich fast alles und kann alles sagen, was ich für meine Arbeit auf der Straße brauche. Gelernt habe ich das von den Truckern, die ich angehalten habe. Polnische Fahrer fangen sehr oft an zu betteln: Bitte lassen Sie mich gehen, ich habe das nicht gewusst, es war das erste Mal, es war das letzte Mal und so weiter. Da lernt man schnell.
Inzwischen komme ich in meinem Job auf sehr vielen Sprachen klar: ukrainisch, russisch, bulgarisch, rumänisch, englisch, deutsch, polnisch, das geht. Die einzige Sprache, in der ich mir nichts merken kann, ist ungarisch. Das ist schrecklich schwer! Und die Fahrer aus Ungarn können in 90 Prozent der Fälle überhaupt keine andere Sprache oder möchten keine andere Sprache sprechen. Das macht es etwas kompliziert. Ich muss dann zu Zeichensprache, Stift und Papier übergehen. Ich schreibe ’50 Euro’ auf ein Blatt, nehme es in die eine Hand, den Führerschein des Fahrers in die andere, halte sie hoch und sage: ’No Euro, no Führerschein.’ Das funktioniert.
Es ist toll, bei der Arbeit viele unterschiedliche Menschen zu treffen. Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Aber sie freuen sich nicht unbedingt, wenn sie mich sehen. Deswegen bin ich so freundlich wie möglich und komme immer mit einem Lächeln an ihr Fenster. Dann bin ich nicht automatisch ihr Feind und sie sind nicht so nervös. Fast immer bleiben die Fahrer freundlich, nur sehr wenige machen Probleme. Dann mache ich auch Probleme. Theoretisch könnte ich sogar das Nummernschild abnehmen, so dass sie nicht weiterfahren können, das passiert aber fast nie.
Eigentlich klappt es immer, dass die Leute zufrieden weiterfahren, selbst wenn ich ihnen eine Strafe geben muss. Ich erkläre halt, warum, und habe auch ein wenig Spielraum. Wenn sie hören, dass es viel teurer hätte sein können, sind sie dankbar, wenn die Sache glimpflich ausgegangen ist. Eine Zeit lang habe ich darüber nachgedacht, ob ich bei der Feuerwehr nicht besser aufgehoben wäre. Ich fänd es schöner, wenn ich in meinem Job nur helfen würde und keine Strafen vergeben müsste. Aber als Polizist mit Hochschulstudium verdiene ich noch verhältnismäßig viel für die Ostslowakei. Es würde keinen Sinn machen, bei der Feuerwehr in der Hierarchie wieder ganz unten anzufangen.“
„Das schönste Wort,
das ich kenne, ist das deutsche Wort ’genießen’. Man kann das leicht sagen und es hat so eine weiche Endung – ’genießen’. Außerdem ist es vielseitig einsetzbar. Essen, Trinken, das Leben – all das kann man genießen. Ein gutes Wort ist das. Ich bin ein Genießer der kleinen Dinge. Gestern lag ich hier auf der Bank und habe durch die Krone des Walnussbaums hoch in den Himmel geguckt und mich über den Baum und die Blätter gefreut.
Ich genieße es auch, meinen Rasen zu mähen. Momentan mach ich das zweimal in der Woche. Für manche mag das komisch klingen: Aber den Rasen direkt vor dem Haus, in dem ich mit meinen Eltern wohne, habe ich erst vor vier Jahren gesät. Es ist Parkgras, das ist sehr schön, hält aber auch was aus. Wenn ich den Rasen mähe, ist das so was wie ein Hobby. Bei der Wiese rund um unser Grundstück, zwischen Apfelbäumen und Scheune ist das anders. Das ist Arbeit.
Ich arbeite viel zuhause mit. Es ist immer was zu tun: Holz hacken, Holz stapeln, eine Mauer ausbessern. Dafür ist es gut, dass ich bei der Polizei im Schichtdienst bin und 15 Tage im Monat frei habe. Ich habe also zwei verschiedene Alltage. Wenn ich zuhause bin, arbeite ich eher körperlich. Da muss ich nicht denken und sehe am Abend, was ich gemacht habe, das gefällt mir. Allerdings bin ich dann auch kaputt. Wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich das ganze Leben mit dem Kopf oder mit meinem Körper arbeiten müsste, würde ich mich für den Kopf entscheiden. Da hält man die Arbeit länger durch und zerstört sich nicht so sehr. Alte Leute, die ihr Leben lang mit dem Kopf gearbeitet haben, sehen besser aus als solche, die jeden Tag körperlich gearbeitet haben.
Andererseits merke ich auch, dass mein Kopf sehr voll ist, wenn ich eine hektische Woche bei der Polizei hatte. Dann brauche ich Natur um mich und gehe mit meinem Schäferhund Stella in den Wald. Das ist, als würde ich den Reset-Knopf drücken.
Ich bin halt auch in einem Dorf ohne Kneipe aufgewachsen. Dafür kenne ich alle 150 Menschen hier mit Vor- und Nachnamen. Als Kinder haben wir in den Schulferien nachmittags immer zusammen Fußball gespielt. Danach sind wir losgezogen und haben trockenes Holz gesammelt, sind nach Hause gerannt, haben uns mit Würstchen eingedeckt und sie abends zusammen über dem Feuer gegrillt. Inzwischen sind alle Freunde in meinem Alter weggezogen und haben schon ein oder zwei Kinder. Mich zieht es hier nicht weg. Bei meinem jüngeren Bruder ist das anders. Er wollte unbedingt nach Kanada und hat das auch hingekriegt. Er schafft immer, was er schaffen will. Deshalb bin ich sehr stolz auf ihn! Für mich wäre es später vielleicht praktisch, etwas näher an einer Stadt zu wohnen, damit die Wege zur Arbeit und zum Einkaufen nicht so lang sind. Aber darüber kann ich nachdenken, wenn ich irgendwann eine eigene Familie gründen und ein Haus bauen möchte. Das muss jetzt noch nicht sein. Dafür genieße ich meine Freiheit zu sehr.“